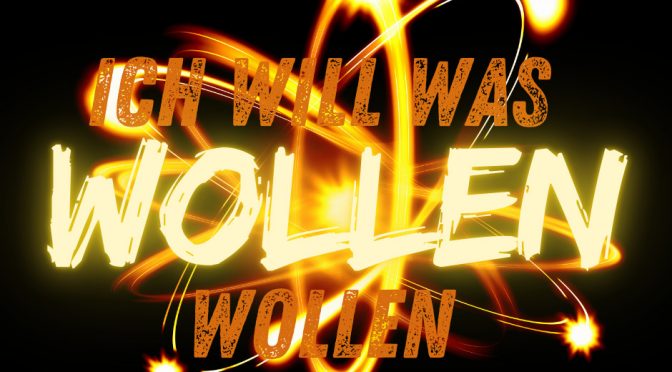Ich kannte sie lange. Die Bindungstheorie.
Doch erst als ich Bruce Chatwins „Traumpfade“ gelesen hatte, der den Bindungstheoretiker John Bowlby zitiert, konnte ich sie auf mich beziehen. Ich schrieb damals ganze Passagen in mein Tagebuch ab:
„Nach einer genaueren Untersuchung der Ursachen für Angst und Zorn bei ganz jungen Menschen, kam Dr. Bowlby zu dem Schluß, daß die komplexen instinktiven Bande zwischen einer Mutter und ihrem Kind – die Entsetzensschreie des Kindes (ganz anders als das Wimmern aufgrund von Kälte, Hunger oder Krankheit), die „unheimliche“ Fähigkeit der Mutter, diese Schreie zu hören, die Angst des Kindes vor dem Dunkeln und vor Fremden, sein Grauen vor schnell nahenden Gegenständen, seine Alpträume von bedrohlichen Ungeheuern, wo nichts dergleichen existiert – […] tatsächlich durch die ständige Anwesenheit von Raubtieren im urzeitlichen Lebensbereich des Menschen erklärt werden könnten.
„Die wichtigste Quelle des Schreckens in der Kindheit ist Einsamkeit.“ Ein einsames Kind, das in seinem Bettchen schreit und strampelt, […] – wenn man das Bettchen in das afrikanische Dornengestrüpp stellt -, weil es, wenn die Mutter nicht in wenigen Minuten zurückkommt, von der Hyäne geschnappt werden wird.
Jedes Kind scheint eine angeborene innere Vorstellung von der „Sache“ zu haben, von der es angegriffen werden könnte: so stark, daß jede bedrohliche „Sache“, selbst wenn es nicht die wirkliche Sache ist, eine vorhersehbare Sequenz defensiven Verhaltens auslösen wird. Die Schreie und das Strampeln sind die erste Verteidigungsstrategie. Dann muß die Mutter darauf vorbereitet sein, für das Kind zu kämpfen, und der Vater, für sie beide zu kämpfen. In der Nacht ist die Gefahr doppelt so groß, weil der Mensch nachtblind ist und die Raubkatzen nachts jagen. […]
Besucher der Säuglingsstation eines Krankenhauses wundern sich oft über die Stille. Doch wenn die Mutter ihr Kind wirklich verlassen hat, ist seine einzige Chance, zu überleben, daß es stumm bleibt.“
So weit das Zitat.
Und dieser letzte Satz war es, der mir in die Knochen schoss .
Meine Oma erzählt mir auch immer, dass ich als Baby nicht geschrien habe. Sie musste nur alle vier Stunden nach mir gucken. Zum Füttern natürlich. Das hat mich schon irgendwo getroffen.
Nach dieser Erkenntnis interessierte mich die Bindungstheorie – und ihre offensichtlichen Auswirkungen auf mein Leben – natürlich noch mehr.
Ich erkannte, das sie mein Leben bestimmt.
Inzwischen sehe ich sie als meine wahre Superkraft an, nicht nur in meinen Kindertherapien, sondern insbesondere auch in meinen Coachings für Erwachsene. Allein, dass ich von ihrer Bedeutung weiß und ihre Auswirkungen auf mein Leben begonnen habe zu durchdringen.
Mit meinen Gedanken über die Bindungstheorie habe zum ersten Mal damit experimentiert, den Inhalt nicht auf einmal zu bieten, sondern nach und nach zu vertiefen, sodass ich bei jedem neuen Aspekt, der dazukommt, alles vorherige wiederholt habe.
Erst kommt eine Runde über die Testsituation, aus der sie entstand. Danach gehe ich im nächsten Rundgang genauer auf die Kinder ein, die entweder sicher oder unsicher gebunden sie kõnnen, und wie sich das zeigt.
In der darauffolgenden Runde nehme ich die Eltern unter die Lupe. Die bringen ja auch eine Bindung aus ihrer Kindheit mit, die bestimmend dafür ist, wie sie mit der nächsten Generation umgehen werden.
Und bevor ich die im Erwachsenenalter sich daraus ergebenden Partnerschaftskonstellationen anspreche, gibt es noch eine Runde, in der ich alle drei Ebenen auf einmal darstelle.
Ich beginne mit meinem persönlichen Zugang.

Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die zu mir finden, einen ähnlichen Start ins Leben hatten, wie ich ihn hatte.
Ich kenne überproportional viele Inkubatorkinder.
Und vielen ist nicht klar – wie es auch mir lange nicht bewusst war – dass das ein frühkindliches Trauma ist.
Aber stellt es euch doch einmal vor!
Da ist ein Neugeborenes. Es liegt verdrahtet in einer gläsernen Maschine, statt auf der Brust seiner Mutter, wenn es zum ersten Mal mit dieser Welt in Kontakt kommt. Über Wochen und Monate allein.
Die Inkubatorerfahrung ist kein klassisches Trauma mit einem Ereignis. Sie ist ein Mangeltrauma. Was fehlt, ist die Resonanz der Welt auf das eigene Dasein, das Willkommen im Körper, die erste Beziehungsantwort.
Diese Erfahrungen sind nicht erinnerbar, aber tief verankert – in der Körperspannung, im Atemmuster, im Blickverhalten, in der Art, wie jemand sich selbst innerlich spürt, oder eben nicht spürt.
Die Betroffenen erleben häufig ein chronisches Gefühl des „Nicht-ganz-Dazugehörens“, eine übersteigerte Selbstbeobachtung bei gleichzeitiger Flucht vor den Innenwelten. Sie haben das Gefühl, anders zu sein, ohne Worte dafür zu haben.
Wir haben Schwierigkeiten mit tiefer emotionaler Beteiligung oder überhaupt dem Spüren unserer eigenen Gefühlswelten (im Gegensatz zu denen der anderen, da sind wir mittendrin).
Wir werden Hochsensitive, und Hochbegabte.
Mit meiner eigenen Inkubatorbiographie und einem besonderen Resonanzfeld für Betroffene erlebe ich in meiner Praxis immer wieder die typischen Spätfolgen dieser frühen Trennungserfahrung – bei Menschen, die rein medizinisch als gesund gelten, aber innerlich bis heute auf der Suche sind.
Ohne zu wissen, wonach. Denn es gibt kein Referenzgefühl für Geborgenheit.
Die Welt wollte uns nicht.
Der Körper erhält keine Einladung, hier zu sein, ist nicht willkommen.
Ein Frühchen im Inkubator erlebt keine wärmende Haut, keinen direkten Blickkontakt, kein Halten im Atemrhythmus eines anderen Körpers.
Es erlebt Geräusche, grelles Licht, Fremdreize. Sensorische Überforderung.
Im Körper zeigen sich diese frühen Erfahrungen oft als diffuse Körperwahrnehmung, unklare Raumorientierung, in Gleichgewichtsstörungen und gestörter Selbstregulation bei Berührung, Nähe oder Reizbelastung. Es gibt keinerlei Hilfe bei der sensorischen Integration.
Das Kind „kommt nicht an“. Und viele Erwachsene sind es bis heute nicht. Sie wohnen nicht in ihrem Körper. Sie sind sich selbst kein sicherer Ort.
Meine Wahrheit war immer geprägt von dem Grundgefühl „Ich bin allein auf dieser Welt.“
Fehlende Koregulation in der frühen Kindheit wird häufig kompensiert durch kognitive Kontrolle, Wissen, Ordnung, Planung, und durch soziale Anpassung. Viele von uns sind als Kind unauffällig, freundlich, leistungsbereit, denn alles andere wäre gefährlich.
Wir haben eine auffällige Fähigkeit zur Anpassung, ohne uns wirklich zu zeigen.
Wir wählen verbalen Ausdruck statt emotionaler Resonanz. Flüchten in den Geist.
Viele Inkubatorkinder haben sich über Sprache gerettet – sie war ihr Regulierungskanal, ihr Resonanzboden, ihr Zuhause. Sie entwickeln häufig extrem frühe und hohe sprachliche Kompetenzen, während ihre Körperlichkeit unterentwickelt bleibt. Sie lernen früh, sich über ihre Intelligenz zu steuern. Oder sich zurückzuziehen, bevor sie beschämt werden.
Ich erkläre mir meine Gefühle, anstatt sie zu fühlen.
Insofern bestimmt die Bindung auch die Art unserer Sinneswahrnehmung. Hier helfen mir die Denk- und Wahrnehmungsmuster von Dawna Markova, diese Zusammenhänge zu begreifen.
Liest man über bindungsvermeidende Kinder, dann geht es immer darum, dass diese auf ihre Bezugsperson zwar äußerlich nicht reagieren und scheinbar ohne Reaktion auf ihr Kommen und Gehen weiterspielen, doch im Inneren tobt ein Sturm. In Wirklichkeit sind sie oft hochgradig überflutet – und schutzlos.
Bindung basiert im besten Fall auf Sicherheit, Rhythmus, Synchronisation, Berührbarkeit.
Fehlt dieser Einstieg, erlebt das Nervensystem andere Menschen als potentiell bedrohlich oder überwältigend – selbst ohne konkrete negative Erfahrungen.
Viele Inkubatorkinder haben im späteren Leben vermeidende oder ambivalente Bindungsmuster, eine starke Sehnsucht nach Nähe, aber Angst vor Vereinnahmung.
Wir sind oft Bindungssuchende mit einem gestörten Empfänger.
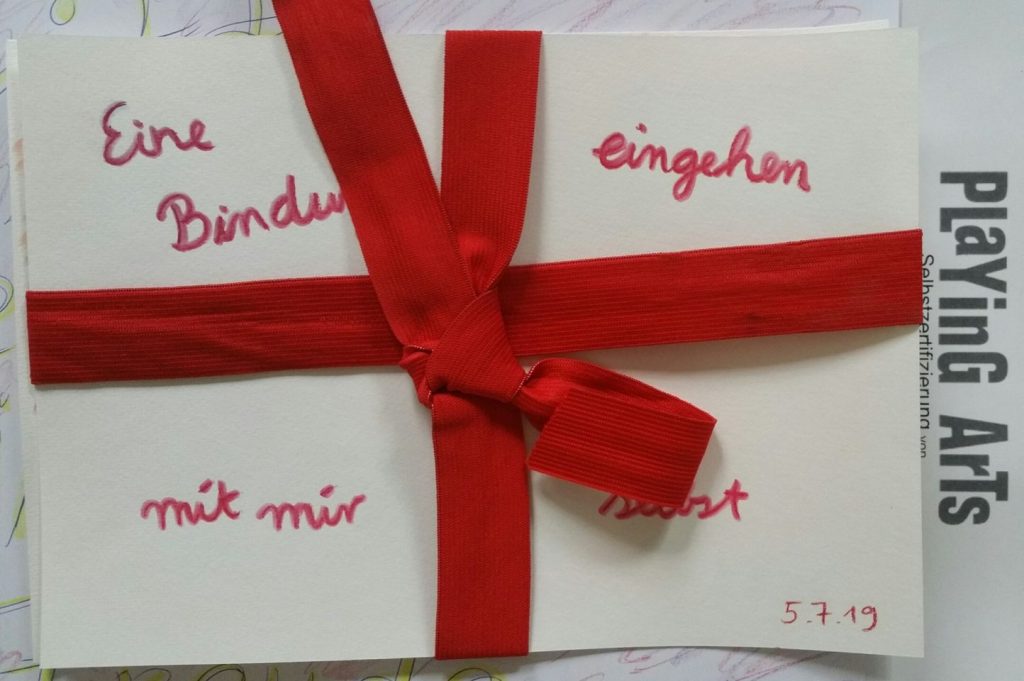
Aber nun erst einmal von vorn. Was ist mit der Bindungstheorie überhaupt gemeint?
Was Bindung ist – und warum sie uns alle betrifft
Bindung ist das emotionale Band zwischen einem Kind und seinen engsten Bezugspersonen. Schreien, Strampeln, Suchen nach Blickkontakt sind Signale, die in der Evolution überlebenswichtig waren: In einer Welt voller Gefahren konnte nur das Kind überleben, das Nähe herstellte – Nähe bedeutete Schutz.
John Bowlby entwickelte die Bindungstheorie in den 1950er- und 60er-Jahren. Er sah Bindung nicht als bloßen Trieb, sondern als eigenständiges Verhaltenssystem: Es wird aktiviert, wenn Gefahr droht, und beruhigt, wenn Nähe sicher ist. Mary Ainsworth prägte später den Begriff der sicheren Basis – die verlässliche Bezugsperson, von der aus ein Kind die Welt erkunden kann und zu der es zurückkehrt, wenn es erschrickt.
Berühmt und umstritten zugleich wurde der Fremde-Situationen-Test, den Ainsworth entwickelte. Ganz grob wiedergegeben wird dort geguckt, wie Kinder im Alter von zwölf bis achtzehn Monaten auf eine kurze Trennung von der Mutter in Bezug auf Bindungsverhalten und Explorationsverhalten – in dem Falle Erforschen des herumliegenden Spielzeugs – reagieren, wenn sie mit einer fremden Person alleingelassen werden.
Entscheidend war nicht das Weinen beim Weggehen, sondern das Verhalten beim Wiedersehen. Suchte das Kind Nähe? War es wütend? Wirkte es gleichgültig? Bei einer Gruppe zeigte sich die Mutter als die “sichere Basis”, die sie auch sein sollte. Aus den beobachteten Mustern entstanden die vier heute bekannten Bindungsstile: sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent und später fügte Mary Main noch unsicher-desorganisiert hinzu.
Schon hier beginnt berechtigte Kritik. Die Saat zu diesem Artikel legte Heidi Keller, deren Titel „Mythos Bindungstheorie“ mich 2019 auf der didacta ansprang. Sie stellt heraus: Der Test fand im Labor statt, mit kleinen Stichproben, und er war stark auf die Mutter fixiert. Andere Bezugspersonen – Väter, Großeltern, Geschwister, ganze Dorfgemeinschaften – kamen kaum vor. Und er wurde im Kontext der US-amerikanischen Mittelschicht der 1960er Jahre entwickelt – schwer übertragbar auf Kulturen, in denen Kinder von Geburt an in einem Wir-Verband aufwachsen. Die Mutter und ihr Wirken wird überstilisiert, als gäbe es keine Familie um sie herum.
Und doch: Das Kernstück bleibt gültig. Ich habe ganz klar immer die Möglichkeit gesehen, dass es Großeltern und sogar Nachbarn und Freunde sein können, mit denen ein Kind Bindung aufnimmt, wenn die Eltern aus was für Gründen auch immer nicht zur Verfügung stehen. Wie wir Bindung erleben, prägt, wie wir mit Stress umgehen, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir uns selbst sehen. Bindung ist das Fundament, auf dem wir stehen – oder eben nicht.
Vier Bindungsmuster – und was Kinder daraus machen
Sichere Bindung entsteht, wenn Eltern (oder andere Bezugspersonen) verlässlich und feinfühlig reagieren. Das Kind weint vielleicht beim Gehen, lässt sich aber schnell beruhigen, wenn Mama oder Papa wieder da sind. Es wagt Schritte hinaus in die Welt und kehrt zurück. Aus diesen Wiederholungen entsteht das tiefe Wissen: „Ich bin willkommen. Ich bin gehalten.“
Unsicher-vermeidende Bindung entsteht, wenn Eltern eher distanziert sind, körperliche Nähe meiden oder die Gefühle des Kindes kleinmachen. Das Kind lernt: „Meine Bedürfnisse stören. Ich bin besser dran, wenn ich sie nicht zeige.“ Solche Kinder wirken erstaunlich selbstständig, kaum berührt von Trennungen – innerlich aber sind sie in Stress. Sie haben früh gelernt, sich selbst zu regulieren, statt Bindung zu suchen. Die ”unsicher-vermeidenden“ Kinder schienen wenig unter einer Trennung von der Mutter zu leiden, spielten und explorierten selbstbewusst und suchten beim Wiedersehen mit der Mutter kaum Nähe und Kontakt zu ihr.
Unsicher-ambivalente Bindung entsteht, wenn Eltern unberechenbar sind – mal überfürsorglich, mal abweisend. ”Unsicher-ambivalente“ Kinder zeigten kaum Explorationsverhalten und waren vor allem damit beschäftigt, die Nähe und den Kontakt zur Mutter aufrecht zu erhalten. Das Kind klammert, weil es nie weiß, wann jemand verfügbar ist. Sie litten sehr stark unter einer Trennung und suchten danach engen Kontakt zur Mutter, während sie gleichzeitig Wut und Ärger gegen sie zeigten. Teilweise verhielten sie sich auch passiv und weinten trotz Nähe der Mutter. Es weint verzweifelt bei Trennung, lässt sich aber kaum beruhigen, wenn die Mutter zurückkehrt. Nähe und Ärger mischen sich, Vertrauen bleibt fragil.
Unsicher-desorganisierte Bindung entsteht, wenn die Bezugsperson selbst Quelle von Angst ist – durch Gewalt, Vernachlässigung oder ungelöste Traumata. Das Kind erlebt: „Du sollst mich trösten – aber du machst mir Angst.“ Die Kinder, deren Bindungsmuster als ”unsicher-desorganisiert“ bezeichnet wird, zeigten kurze Momente, in denen sie weder Bindungsverhalten noch Explorationsverhalten an den Tag legten. In diesen Momenten wirkten die Kinder wie erstarrt, führten begonnenes Verhalten nicht zu Ende oder zeigten gleichzeitig oder kurz hintereinander widersprüchliches Verhalten, wankend zwischen Nähe und Flucht. Später ist Vertrauen besonders schwer – und doch bleibt die Sehnsucht nach Geborgenheit.
Das Entscheidende: Diese Muster sind keine „Fehler“, keine Charaktereigenschaften. Sie sind kluge Überlebensstrategien. Jedes Kind macht das Beste aus dem, was verfügbar ist.
Und genau deshalb kann es sich auch verändern. Im Laufe unseres Lebens, mit anderen Menschen, können wir Vertrauen fassen und Sicherheit finden.
Und nicht jeder hat gleich ein ausgemachtes frühkindliches Trauma, wie es der Ausgangspunkt meiner Forschung war.
Bindung ist ein Beziehungstanz. Das Kind gibt Signale, die Eltern reagieren. Doch auch Eltern haben ein bestimmtes Bindungsmuster, das bestimmt, wie sie mit ihren Kindern umgehen werden. Was wiederum die Bindungserfahrung der nächsten Generation bestimmt.
Ob die Antworten verlässlich sind oder nicht, formt das innere Arbeitsmodell: „So ist die Welt. So bin ich. So sind Beziehungen.“
Feinfühligkeit schlägt Perfektion. Eltern müssen nicht immer richtig reagieren, sondern nur oft genug und vor allem: reparieren.
Nicht-Antwort prägt Unsichtbarkeit. Wenn ein Kind oft ignoriert wird, lernt es, seine Gefühle nicht mehr zu zeigen.
Unberechenbarkeit macht klammerig. Wer mal getröstet, mal abgewiesen wird, lebt in ständiger Alarmbereitschaft.
Angst in der Bindung zersplittert Strategien. Wenn die, die trösten sollten, selbst Furcht auslösen, geraten Nähe und Flucht in Konflikt.
So entstehen Muster, die oft unbemerkt von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Eltern mit unsicherer Bindung tun das nicht, weil sie versagen, sondern weil sie ihre eigenen Wunden unbewusst weitertragen. Nicht umsonst war und ist mein Claim, immenses Expertenwissen als Versagermutter zu haben.

Wie sieht das also genau aus?
Wie Bindungsmuster weitergegeben werden – Eltern prägen Kinder
Bindung ist kein Merkmal des Kindes, sondern eine Beziehungserfahrung. Das heißt: wie Eltern (oder andere Bezugspersonen) auf die Bedürfnisse des Kindes reagieren, prägt dessen inneres Arbeitsmodell von „Nähe und Distanz“.
Sichere Eltern
- reagieren verlässlich, trösten, ohne zu erdrücken, lassen erkunden, ohne zu bestrafen.
- Ihre Kinder entwickeln Vertrauen: „Ich bin willkommen. Die Welt ist sicher.“
Vermeidende Eltern
- sind distanziert, gefühlsarm oder lehnen Nähe ab.
- Ihre Kinder lernen: „Meine Bedürfnisse stören. Ich bin besser dran, wenn ich sie nicht zeige.“
Ambivalente Eltern
- sind unberechenbar, mal überfürsorglich, mal abweisend.
- Ihre Kinder lernen: „Ich weiß nie, ob jemand für mich da ist. Ich muss klammern, sonst verliere ich dich.“
Desorganisierte Eltern
- sind selbst Quelle von Angst: durch Gewalt, Vernachlässigung, Traumata.
- Ihre Kinder erleben: „Die Person, die mich trösten sollte, macht mir Angst. Ich will Nähe – und muss zugleich fliehen.“
Das Kind macht also nicht „falsch“, was es tut. Es passt sich an.
Bindungsmuster sind Überlebensstrategien.
Und für uns als Erwachsene gilt: Strategien kann man ändern.
Vielleicht ist das die schönste Erkenntnis:
Unsere größte Wunde kann zu unserer größten Stärke werden – wenn wir beginnen, sie als Teil unserer Geschichte anzunehmen.
Warum ich nämlich schon ziemlich lange fest davon überzeugt bin, dass das frühkindliche Bindungsverhalten eine ganz große Rolle im Erwachsenenleben spielt, das liegt daran, dass ich seit dem letzten Jahrtausend bereits verheiratet bin. Ich hoffe, mein Mann verzeiht, wenn ich meine größte Erkenntnis hier als Anekdote zum besten gebe:
Als unsicher-vermeidend Gebundene habe ich mich beispielsweise in den ersten Jahren unserer Ehe komplett gefesselt gefühlt. Nichts konnte ich allein machen. Ich war wie eingesperrt. Es hat mich einfach nur erdrückt. Ich hatte keine Luft zum Atmen für mich und meinen Freiheitsdrang.
Was wollte dieser Mann von mir?
Er wollte das, was normale und sicher gebundene Menschen eben so wollen. Nähe!
Ich wusste nicht einmal, wozu das gut sein soll.
Sehr viel früher hätte ich das durchaus auch noch anders formuliert. Da ging ich davon aus, ich würde aktiv eingesperrt werden – mir war nicht klar, dass es sich für mich lediglich so anfühlte. Heute weiß ich, dass ich vieles davon selbst produziert habe, weil ich mir einfach keinen Ausgleich geschaffen habe.
Was anderen selbstverständlich zufiel, musste ich erst lernen.
Und das wohl lebenslang.
Ich habe kürzlich eine Aufstellungsarbeit gemacht, in der es um das Thema Halt ging. Ich dachte, gehalten zu werden wäre ein Grundgefühl, das ich gern als Unterstützung in meinem System etablieren wollte. Ich dachte, es sei eine Grundvoraussetzung des Menschseins.
Und als ich dann da stand, auf einem sehr niedrigen Level des Gehaltenseins, schrie alles in meinem System Nein. Nein! Niemals lasse ich zu, dass mich jemand anders hält. Ich will das gar nicht. Das ist falsch.
Mein Körper weiß gar nicht, wie das geht. Mich in jemand anderen fallenzulassen. Nach Jahren der Selbstführung noch immer nicht.
Und hier wird für mich besonders deutlich, was sich eben aufgrund unseres Bindungsverhaltens ausprägt, das uns – wie dieses – bis an unser Lebensende bestimmen wird: Die Funktion unseres Nervensystems.
Manchmal komme ich mir echt albern vor, aber es scheint für Menschen mit einem frühkindlichen Trauma tatsächlich normal zu sein, dass manche Dinge, über die die meisten anderen überhaupt nicht nachzudenken scheinen, eine unfassbare Anstrengung kosten.
Mein autonomes Nervensystem, in Form des Sympathikus lässt regelmäßig grüßen. Bei mir peitscht alles ganz schnell hoch und dann bin ich damit erst einmal nur damit beschäftigt … Ruhe zu bewahren.
Mir hat es extrem geholfen, zu verstehen, dass das
a) normal ist, nicht nur für mich, sondern für die meisten von uns und
b) wie unfassbar einfach es ist, das Nervensystem runterzufahren.
Deswegen habe ich die Erkenntnisse aus der Polyvagaltheorie, und vor allem die sich daraus ergebende Selbstregulationspraxis (etwas, das mir meine unsicher vermeidende Bindung quasi vor die Füße gelegt hat), als feste Größe in meinem Selbstheilungskurs untergebracht.
Die Polyvagaltheorie hat uns die Erkenntnis geschenkt, dass zum Nervensystem nicht nur das sympathische Kampf- oder Fluchtverhalten und der parasympathisch gesteuerte Totstellreflex gehört, der sich als hinterer Strang des Nervus vagus herausstellte, sondern dass es ebenso den vorderen Strang des Nervus vagus gibt – und das ist das soziale Bindungssystem.
Und Verbindung – die Verbindung mit dem Großen Ganzen, Verbindung mit Himmel und Erde, Verbindung mit der Welt, Verbindung mit anderen Menschen, insbesondere die Verbindung mit mir selbst, das ist mein Schlüssel zur Heilung.
Und ich sah mich kürzlich darin bestätigt innerhalb meiner Ausbildung zur Kreativ-Integralen Traumatherapeutin, als ich Milena Hauptmann sagen hörte: Bevor es um irgendwelche Diagnosen geht, ist in der Traumatherapie der Kontakt grundlegend: Welche Bindung hat jemand? Und danach geht es um das zentrale Nervensystem, wie reagiert jemand. Es ist so existentiell.
Wer sich für diese besonderen Auswirkungen auf die Aktivierung des sympathischen Netzwerk in Form von Kampf- oder Fluchtreaktionen, sowie der parasympathischen Aktivierung, dem Freeze, aber eben auch dem sozialen Bindungssystem interessiert, sei auf meinen Artikel über die Schematherapie verwiesen, die das klar verdeutlicht.
Unsere Bindung bestimmt, wie wir mit uns und anderen umgehen.
Für mich ist die Bindungstheorie die Grundlage allen menschlichen Zusammenseins, als unsere Grundprägung, die nicht nur über unsere Wahrnehmung und die Beschaffenheit der Funktion unseres Nervensystems, sondern über die Natur unserer persönlichen Realität bestimmt.
Denn die meisten Überlebensmuster, die Menschen entwickeln, sind im Kern Störungen der Interaktion, der Beziehungsgestaltung. Wenn man Rainer Sachse zuhört, mit seinem positiven Blick, werden selbst handfeste Diagnosen wie Persönlichkeitsstörungen nur fälschlicherweise so genannt, und sind eigentlich Bindungsanzeiger.
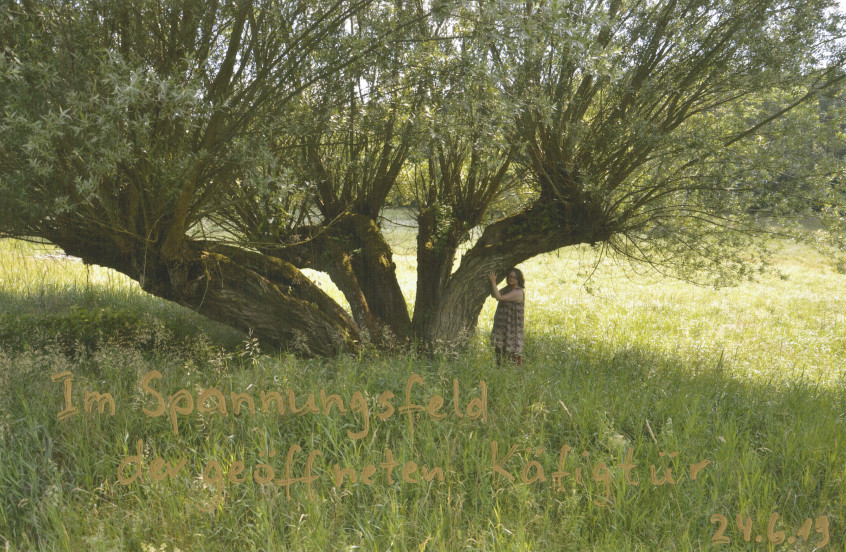
Aus diesem Grunde möchte ich noch eine dritte Rundreise durch die Bindungsstile machen, und diesmal die Auswirkungen auch auf unsere Partnerschaften mit einbeziehen, die wir als Erwachsene eingehen. Diese hatte ich das Privileg, in meiner aktuellen Ausbildung zum VITA-Coach von Layla Martin zu empfangen.
Stan Tatkin, Paartherapeut und Neuropsychologe, hat für diese Muster Bilder geprägt, die mich sehr ansprechen. Er nennt die sicher Gebundenen Anker. Sie sind so etwas wie die lebendige Verkörperung von Bowlbys „sicherer Basis“. Sie sind stabil, ausgeglichen, fühlen sich sowohl in Nähe als auch in Distanz wohl. Sie können Beziehungen eingehen, ohne sich zu verlieren – und sie können alleine sein, ohne in Panik zu geraten.
Typische Sätze aus ihrem Inneren könnten lauten: „Mir geht es allein gut, aber mit dir an meiner Seite ist es schöner.“ oder „Ich liebe Menschen, und meistens lieben Menschen mich.“
Ihre Stärke ist die Flexibilität: Nähe, Distanz, Rückzug, Begegnung – all das dürfen gleichzeitig da sein. Ihre Verletzlichkeit liegt einzig darin, diese sichere Bindung zu verlieren. Ansonsten sind sie die Menschen, die in stürmischen Zeiten Halt geben.
Die Insel ist das Bild für den unsicher-vermeidenden Bindungsstil. Menschen mit diesem Muster haben früh gelernt: „Ich komme besser klar, wenn ich mich auf mich selbst verlasse.“ Sie sind unabhängig, kreativ, produktiv – solange man ihnen Raum lässt. Sie nehmen sich gern Rückzugsinseln und brauchen diese wie andere die Luft zum Atmen.
Doch die Insel trägt auch ihre Verletzlichkeit: Sie fürchtet, von Nähe überrannt zu werden, sich gefangen oder außer Kontrolle zu fühlen. Intimität kann schnell als Bedrohung empfunden werden. Und tief innen liegt die Angst, für etwas verantwortlich gemacht oder gar beschuldigt zu werden.
Das bedeutet nicht, dass Insel-Menschen nicht lieben – im Gegenteil. Aber sie zeigen es leiser, vorsichtiger, manchmal verkopfter. Nähe darf niemals erdrücken.
Und die unsicher-ambivalent Gebundenen nennt er Wellen – sie sehnen sich nach intensiver Nähe, schenken Leidenschaft und Intensität, doch in ihnen rollt gleichzeitig die Angst, wieder verlassen zu werden.
Menschen mit diesem Muster sind oft großzügig, liebevoll, fürsorglich, geradezu überschwänglich in ihren Beziehungen. Sie fühlen sich am lebendigsten, wenn andere in ihrer Nähe sind.
Doch sie kämpfen mit der Unsicherheit: „Wirst du bleiben? Oder gehst du?“ Ihre Verletzlichkeit ist die Angst vor Trennung und Zurückweisung. Sie ertragen das Alleinsein nur schwer und haben oft das Gefühl, eine Last zu sein. Sie brauchen viel Bestätigung, um sich wirklich sicher zu fühlen.
Desorganisierte Partner zeigen uns die Widersprüche und die Sehnsucht nach wahrer Sicherheit. In Tatkins Modell kommen sie nicht vor.
Diese Bilder helfen, weil sie die inneren Bewegungen greifbar machen. Jeder von uns kennt Momente, in denen er zur Insel wird – zurückzieht, abschottet. Oder zur Welle – die Nähe will und doch zweifelt. Und vielleicht auch den Anker – den Zustand, in dem wir ruhig, vertrauend, geerdet sind.
Also los gehts. Nochmal, und noch ausführlicher!
Das sichere Bindungsmuster
Ein sicher gebundenes Kind wächst mit dem Gefühl auf: „Die Welt ist im Grunde ein guter Ort. Ich darf mich ausprobieren, weil da jemand ist, zu dem ich jederzeit zurückkehren kann.“
Die Bezugsperson ist stabil und verlässlich. Sie reagiert feinfühlig – nicht perfekt, aber gut genug, um Sicherheit zu vermitteln. Sie hört die Signale ihres Kindes, spiegelt sie, beruhigt es, wenn es Trost braucht, und lässt es los, wenn es entdecken will. Nähe wird angeboten, ohne zu erdrücken. Distanz wird erlaubt, ohne Liebesentzug.
Das Kind selbst zeigt dieses Vertrauen deutlich: Es weint vielleicht, wenn Mama oder Papa den Raum verlassen, lässt sich aber schnell trösten, sobald sie zurückkommen. Es spielt, probiert Dinge aus, geht kleine Risiken ein – und kommt immer wieder zurück zu seiner sicheren Basis. In dieser wiederholten Erfahrung entsteht innerlich ein Bild: „Ich bin gehalten. Ich darf. Ich kann.“
Als Erwachsene bringen Menschen mit sicherer Bindung genau dieses Vertrauen in ihre Beziehungen ein. Sie haben ein Gespür für ein gutes Gleichgewicht: Nähe und Distanz dürfen gleichzeitig existieren. Sie suchen Verbundenheit, ohne sich selbst zu verlieren, und können auch mal allein sein, ohne in Panik zu geraten. Sie können Grenzen setzen, ohne Mauern hochzuziehen. Verluste schmerzen, aber sie zerbrechen nicht. Sie sind fähig, sich einzulassen, zu vertrauen – und nach Enttäuschungen wieder zu heilen.
Man könnte sagen: Wer sicher gebunden ist, trägt eine innere sichere Basis in sich – eine Art inneres Zuhause, das Geborgenheit schenkt, selbst wenn das Leben draußen stürmt. Einen Anker eben.
Sicheres Bindungsmuster
Bezugsperson:
- Stabil und beständig.
- Relativ feinfühlig und aufmerksam.
- Bietet eine sichere Basis, zu der das Kind immer zurückkehren kann.
- Reflektierend und spiegelnd.
- Reagiert angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes.
- Liebevoll und nährend, ohne einzuengen.
- Ermöglicht dem Kind, die Welt zu erkunden, und bleibt ein verlässlicher Rückhalt.
- Feinfühlig, sowohl auf körperlicher als auch auf verbaler Ebene.
- Kommuniziert durch Augenkontakt, Herz-zu-Herz-Verbundenheit und körperliche Nähe.
Kind:
- Findet schnell Trost, wenn die Mutter zurückkommt.
- Knüpft leicht Bindungen zu neuen Menschen.
- Geht gesunde Risiken ein und erkundet die Welt, kehrt aber zur sicheren Basis zurück.
- Vertraut auf die sichere Basis der Eltern und entwickelt dadurch eine innere Sicherheit, die auch auf die Außenwelt übertragen wird.
- Hat eine breite Toleranzspanne für Emotionen und Frustrationen in Beziehungen.
Als Erwachsene:
- Sucht Beziehungen mit minimaler Vermeidung oder Widerstand.
- Ist in der Lage, eine Vielzahl gesunder Beziehungen mit einem ausgewogenen Maß an Nähe und Freiraum zu führen.
- Erholt sich gut von Verlusten.
- Zeigt Resilienz angesichts von Traumata.
- Hat die Fähigkeit, offen und vertrauensvoll zu sein, während gesunde Grenzen gewahrt werden.
- Besitzt ein starkes Selbstbewusstsein.
Übung: Bin ich ein Anker?
Bei Stan Tatkin klingt das so: Glaubst du, dass du – oder dein Partner – ein Anker sein könntet?
Schau dir diese Liste an und überprüfe sie, zuerst für dich selbst und dann für deinen Partner.
- „Ich komme gut allein zurecht, aber ich ziehe das Geben-und-Nehmen einer nahen Beziehung vor.“
- „Ich schätze meine engen Beziehungen und bin bereit, das Nötige zu tun, um sie in einem guten Zustand zu halten.“
- „Ich komme mit einer großen Vielfalt von Menschen gut zurecht.“
- „Ich liebe Menschen – und Menschen neigen dazu, mich zu lieben.“
- „Meine engen Beziehungen sind nicht fragil.“
- „Viel körperlicher Kontakt und Zuneigung ist für mich völlig in Ordnung.“
- „Ich bin gleichermaßen entspannt, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin oder wenn ich allein bin.“
- „Unterbrechungen durch meine Liebsten stören mich nicht.“
Das unsicher-vermeidende Bindungsmuster
Kinder mit einem vermeidenden Bindungsmuster haben früh gelernt: „Ich komme besser klar, wenn ich meine Bedürfnisse nicht zeige.“
Ihre Bezugsperson war meist wenig feinfühlig oder emotional nicht verfügbar – vielleicht sogar ablehnend, wenn das Kind Nähe oder Trost suchte. Also passte das Kind sich an: Es zeigt kaum Schmerz, kaum Bedürftigkeit, wirkt selbstständig, obwohl es innerlich Halt gebraucht hätte.
So entstehen kleine Erwachsene im Kinderkörper. Sie lernen früh, allein zu funktionieren, ihre Gefühle herunterzufahren und Autonomie über alles zu stellen. Beim Fremde-Situationen-Test spielen sie scheinbar ungerührt, auch wenn die Mutter geht, und wirken distanziert, wenn sie zurückkehrt. Doch unter der Oberfläche tobt ein Sturm, pocht ein zurückgehaltenes Bedürfnis nach Nähe.
Im Erwachsenenleben fühlen sich vermeidend Gebundene wie bereits erwähnt oft schnell eingeengt. Nähe kann sich anfühlen wie ein Käfig. Sie halten Distanz, flüchten in Arbeit, Hobbys oder Rationalität, wenn Beziehungen zu intensiv werden. Sie werden zu ihrer eigenen, selbstgenügsamen Insel. Sie lieben durchaus – aber sie zeigen es vorsichtig, kontrolliert. Was sie am meisten fürchten, ist das Gefühl, ausgeliefert zu sein.
Ihr Bedürfnis ist paradoxerweise das, wovor sie fliehen: Sich sicher gehalten zu fühlen, ohne dass ihre Freiheit verloren geht.
Unsicher-vermeidendes Bindungsmuster
Bezugsperson:
- Blockiert die Nähe-Suche des Kindes, indem sie es zurückweist, sich zurückzieht oder es von sich wegstößt.
- Zeigt Abneigung gegen körperliche Nähe (zuckt zurück, vermeidet Augenkontakt, zieht sich zurück).
- Wirkt distanziert, abweisend, emotional entfernt oder nicht auf die emotionalen Bedürfnisse des Kindes eingestimmt, auch wenn die grundlegenden Bedürfnisse wie Nahrung und Unterkunft erfüllt werden.
Kind:
- Reagiert, indem es wenig Bedürfnis nach Nähe zeigt (keine Bedürfnisse äußert, erscheint selbstständig).
- Hält keinen Kontakt aufrecht und richtet die Aufmerksamkeit stattdessen auf Objekte.
- Ignoriert die Mutter bei der Wiedervereinigung.
- Zeigt sich emotional zurückhaltend.
- Hat scheinbar nur wenige „Bedürfnisse“ oder erfüllt diese selbstständig (obwohl unter der vermeidenden Fassade oft Angst besteht).
Als Erwachsene:
- Zeigt eine abweisende Haltung gegenüber der Bedeutung von Beziehungen und distanziert sich emotional.
- Ist stark auf Selbstständigkeit fokussiert und vermeidet Abhängigkeiten.
- Hat übermäßig starre Grenzen (überentwickelte Abgrenzung).
- Nutzt manchmal Urteile oder Kritik als Mittel, um Abstand zu schaffen.
Übung: Bin ich eine Insel?
Bei Stan Tatkin klingt das so: Glaubst du, dass du – oder dein Partner – eher wie eine Insel bist?
Prüfe einmal diese Aussagen für dich selbst:
- „Ich weiß, wie ich mich besser um mich selbst kümmern kann, als es je jemand anderes könnte.“
- „Ich bin ein Typ, der die Dinge am liebsten selbst macht.“
- „Ich blühe auf, wenn ich Zeit in meinem eigenen, privaten Rückzugsraum verbringen kann.“
- „Wenn du mich verletzt oder verärgerst, muss ich allein sein, um mich zu beruhigen.“
- „Ich habe oft das Gefühl, mein Partner wolle oder brauche etwas von mir, das ich nicht geben kann.“
- „Am entspanntesten bin ich, wenn niemand sonst in meiner Nähe ist.“
- „Ich bin unkompliziert und brauche nicht viel – und ich ziehe Partner vor, die ebenfalls unkompliziert und pflegeleicht sind.“
Das unsicher-ambivalente Bindungsmuster
Ambivalent gebundene Kinder leben mit einer inneren Erfahrung: „Ich weiß nie, ob meine Bezugsperson wirklich da ist, wenn ich sie brauche.“
Ihre Eltern oder Bezugspersonen sind mal sehr zugewandt und liebevoll – und mal unberechenbar, abweisend oder überfordert. Für das Kind bedeutet das Dauerstress: Es klammert, weint, bleibt wachsam. Wenn die Mutter den Raum verlässt, gerät es in Panik, und auch wenn sie zurückkommt, bleibt es untröstlich – denn das Vertrauen, dass sie zuverlässig da ist, fehlt.
Diese innere Unsicherheit wächst mit. Erwachsene mit ambivalenter Bindung sehnen sich nach intensiver Nähe, nach Verschmelzung fast – und gleichzeitig misstrauen sie dieser Nähe zutiefst. „Willst du wirklich bei mir bleiben? Wirst du mich verlassen?“. Eine Welle in ständiger Bewegung.
Sie brauchen viel Bestätigung, sind oft schnell eifersüchtig, schwanken zwischen Anklammern und Ärger. Sie wünschen sich Halt – und fürchten gleichzeitig, dass er ihnen wieder entzogen wird.
Ihr tiefstes Bedürfnis: Konstanz und Verlässlichkeit. Jemanden, der bleibt.
Unsicher-ambivalentes Bindungsmuster
Bezugsperson:
- Handelt inkonsistent und unvorhersehbar.
- Kann das Kind überreizen oder nicht ausreichend auf es eingehen.
- Reagiert eher aus den eigenen Bedürfnissen heraus als auf die des Kindes.
- Könnte emotional selbst bedürftig sein und versuchen, das Kind zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu nutzen.
- Wenn das Kind Liebe oder Unterstützung braucht, ist die Bezugsperson möglicherweise fehlangepasst oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Kind:
- Wird nicht getröstet, wenn die Mutter zurückkommt, und weint weiterhin.
- Zeigt gereiztes Verhalten.
- Ist unsicher, ob die Bezugsperson zuverlässig ist – verhält sich vorsichtig, verzweifelt, wütend, gestresst und ängstlich bei Trennung und Wiedervereinigung (kann nicht beruhigt werden).
- Hat Schwierigkeiten, sich von Stress zu erholen, zeigt schlechte Impulskontrolle, Angst vor Verlassenwerden und impulsives oder herausforderndes Verhalten.
- Hat eine schwierige, oft reizbare Persönlichkeit und zeigt negative Stimmungen.
Als Erwachsene:
- Zeigt starke Abhängigkeit von Beziehungen und ist oft verstrickt in diese.
- Hat Schwierigkeiten, gesunde Grenzen zu setzen (unterentwickelte Abgrenzung).
- Ist übermäßig abhängig von anderen.
- Nimmt Dinge schnell persönlich und ist überempfindlich.
- Zeigt Ängstlichkeit bei Trennungen oder Abschieden.
- Ist hypervigilant (übermäßig aufmerksam auf potenzielle Gefahren oder Verlust).
- Hat Schwierigkeiten, Trost oder Unterstützung anzunehmen.
- Empfindet Verwirrung in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse (diese auszudrücken oder um das zu bitten, was gebraucht wird).
- Entwickelt keine stabile innere Sicherheit.
- Zeigt schlechte Objektkonstanz (die Fähigkeit, Vertrauen und Verbundenheit auch in Abwesenheit der anderen Person zu bewahren).
Übung: Bin ich eine Welle?
Bei Stan Tatkin klingt das so: Glaubst du, dass du – oder dein Partner – eher wie eine Welle bist?
Schau dir diese Aussagen an und spüre hinein, ob sie zutreffen:
- Ich habe ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Intimität.“
- „Ich mache mir oft Sorgen darüber, dass mein Partner mich nicht so sehr liebt, wie ich ihn liebe.“
- „Ich brauche viel Bestätigung von meinem Partner.“
- „Wenn ich verletzt bin, möchte ich das sofort besprechen – ich kann nicht einfach warten.“
- „Ich merke mir alte Kränkungen und bringe sie oft wieder zur Sprache.“
- „Ich sorge mich ständig, dass meine Beziehung enden könnte.“
- „Ich habe Schwierigkeiten, mich zu beruhigen, wenn ich aufgebracht bin.“
Das desorganisierte Bindungsmuster
Hier wird es besonders schmerzhaft. Desorganisiert gebundene Kinder wachsen in einem Umfeld auf, in dem die Bezugsperson selbst Quelle von Angst ist – zum Beispiel durch Gewalt, Vernachlässigung oder unberechenbares Verhalten. Das Kind erlebt: „Die Person, die mich trösten sollte, ist gleichzeitig die, vor der ich Angst habe.“
So entsteht ein innerer Widerspruch: Es möchte Nähe und muss gleichzeitig fliehen. Das führt zu erstarrtem, widersprüchlichem Verhalten – das Kind wirkt chaotisch, manchmal wie „eingefroren“.
Im Erwachsenenalter zeigt sich das oft als tiefe Zerrissenheit: Beziehungen sind ein Wechselspiel aus Sehnsucht und Panik, aus Hingabe und Rückzug. Vertrauen fällt schwer. Trigger können plötzliche Rückfälle in Angst, Wut oder Erstarrung auslösen.
Und doch – auch hier steckt die gleiche Sehnsucht wie in allen anderen Bindungsstilen: nach einem sicheren Hafen, nach dem Gefühl, endlich ohne Angst lieben zu dürfen.
Desorganisiertes Bindungsmuster
Bezugsperson:
- Bedrohlich, missbräuchlich – verbal oder auf andere Weise. Kann einschüchternd wirken, zeigt Mikroausdrücke von Wut oder Hass im Gesicht.
- Kann dissoziativ auf das Kind reagieren, ohne auf dessen Bedürfnisse einzugehen.
- Wechselt plötzlich zwischen emotionalen Zuständen, ohne eine interaktive Reparatur (kein Versuch, eine gestörte Verbindung wiederherzustellen).
- Muss nicht direkt missbräuchlich sein, kann aber selbst desorganisiert sein (z. B. aufgrund eigener Bindungstraumata), wodurch das Kind keine Sicherheit erlernt. Dies ist eine Möglichkeit, wie intergenerationale Traumata weitergegeben werden.
Kind:
- Zeigt widersprüchliches Verhalten: Sucht Nähe, gefolgt von Erstarren oder vermeidet Nähe, während es sie gleichzeitig sucht (gleichzeitig entgegengesetzte Verhaltensweisen).
- Chaotische Ausdrücke und Verhaltensweisen.
- Merkwürdige Bewegungen, wie z. B. Stolpern ohne ersichtlichen Grund, oder Bewegungen in Zeitlupe.
Als Erwachsene:
- Paradoxe Reaktionen auf Kontakt: Misstraut Unterstützung, benötigt sie aber gleichzeitig dringend.
- Kann desorganisiertes Denken zeigen.
- Schwierige, inkonsistente Narrative in der Selbstreflexion oder Erzählung der eigenen Lebensgeschichte.
- Schmerzvolle und instabile Beziehungen.
- Schwierigkeit, sich zu verbinden oder zu vertrauen.
- Selbsthass und ein tiefes Misstrauen gegenüber sich selbst und anderen.
Wie ich als Erwachsene mit mir selbst umgehe, mein Selbstmitgefühl und meine inneren Dialoge, ist ein Ausdruck des kindlich erlernten Bindungsverhaltens.
Paare sind keine Idylle von zwei freien Menschen. Paare sind Nervensysteme, die sich gegenseitig regulieren – oder eben dysregulieren. Wir triggern einander, aber wir können auch lernen, uns zu beruhigen.
- Inseln brauchen den Mut, Nähe zuzulassen, ohne die eigene Freiheit zu verlieren.
- Wellen brauchen die Erfahrung, dass jemand bleibt – auch wenn sie nicht klammern.
- Anker können für beide zum Modell werden: präsent, verlässlich, in Balance.
Und vor allem ist eine der Auswirkungen meiner Bindungsreaktion die, dass ich wenig Zugang zur Welt der Bedürfnisse gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, was ich will, und ich kann dementsprechend auch nur so semi Bedürfnisse äußern.
Daher das Beitragsbild, das ich gewählt habe. Ich will wollen wollen.
Es ist ein weiteres Feld, das sich aus meiner vermeidenden Bindung ergibt.
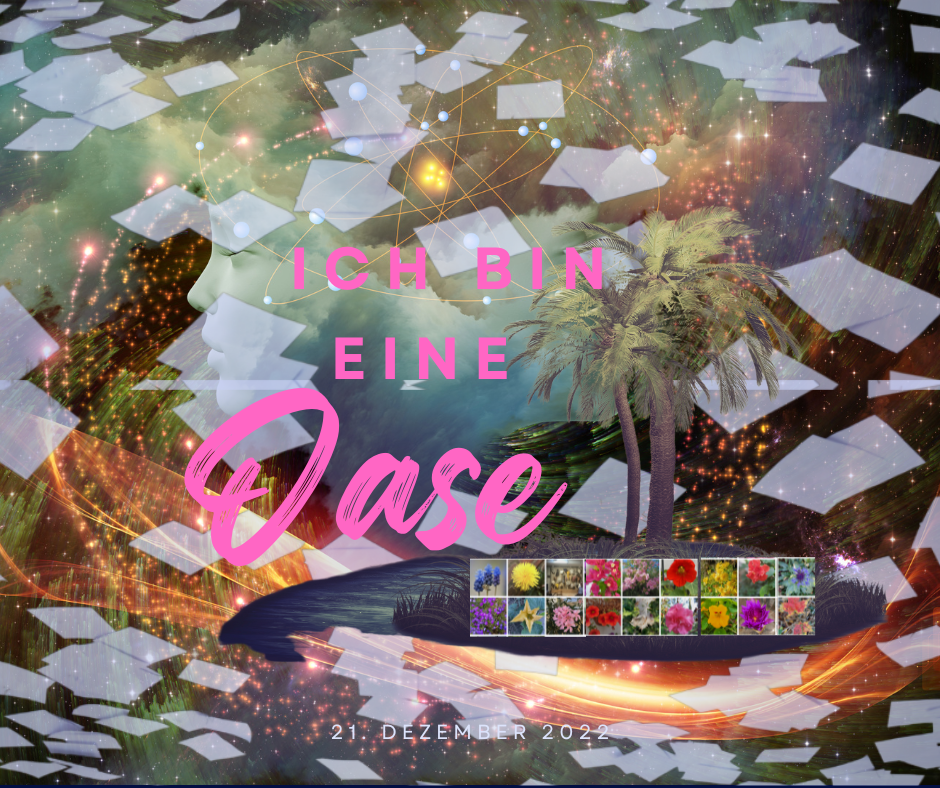
Ich mache nun noch eine weitere Runde in die Bindungsstile hinein, diemal gehe ich von Stan Tatkins Buch „Wired for Love“ aus, das sich sehr anschaulich damit beschäftigt, wie wir als Paare miteinander umgehen.
Bindungsstile in Partnerschaften – Nähe, Distanz und das Drama dazwischen
Wir alle tragen unser Bindungsmuster aus der Kindheit mit in unsere erwachsenen Beziehungen. John Bowlby sprach von „inneren Arbeitsmodellen“, die wir in unseren ersten Jahren entwickeln: Grundannahmen darüber, ob die Welt sicher ist, ob Nähe möglich ist, ob wir willkommen sind. Diese Modelle prägen, wie wir später lieben.
Diese Muster treffen in Beziehungen aufeinander – und erzeugen jeweils ihre eigene Choreografie aus Nähe, Distanz, Rückzug und Sehnsucht.
Sicher gebunden + Unsicher-vermeidend (Anker + Insel)
Dynamik:
Der sicher Gebundene möchte Nähe, Verbindlichkeit, Gemeinsamkeit. Für die vermeidende Person fühlt sich das schnell nach „zu viel“ an. Sie zieht sich zurück, braucht Freiraum, wirkt manchmal kühl.
Stolperfallen:
- Der Anker interpretiert Rückzug als Ablehnung: „Warum willst du nicht bei mir sein?“
- Die Insel empfindet Nähe als Bedrohung: „Warum erstickst du mich?“
So geraten beide in eine Spirale von Missverständnissen.
Chancen:
- Der Anker kann lernen, die Rückzugsräume der Insel zu respektieren, ohne sie als Abwertung zu empfinden.
- Die Insel darf entdecken, dass Nähe nicht automatisch Verlust von Freiheit bedeutet. Kleine Dosen von Verbindlichkeit können heilsam sein.
- Dieses Paar hat Entwicklungspotential: Wenn beide ihre Muster reflektieren, entsteht eine Balance aus Freiheit und Geborgenheit.
Sicher gebunden + Unsicher-ambivalent (Anker + Welle)
Dynamik:
Die Welle sucht intensive Nähe, möchte Bestätigung, fragt ständig: „Bleibst du bei mir?“ Der Anker, stabil und verlässlich, kann diese Sicherheit geben.
Stolperfallen:
- Die Welle interpretiert Ruhe und Gelassenheit des Ankers als Gleichgültigkeit.
- Der Anker fühlt sich durch das hohe Nähebedürfnis überfordert.
Chancen:
- Die Welle kann lernen, die Beständigkeit des Ankers wirklich zu spüren und darin Vertrauen zu finden.
- Der Anker darf lernen, aktiver zu signalisieren: „Ich bin da. Du bist sicher.“
- Solche Partnerschaften sind oft sehr heilend – weil die Welle hier lernt, dass Nähe nicht jederzeit erkämpft werden muss.
Unsicher-vermeidend + Unsicher-ambivalent (Insel + Welle)
Dynamik:
Dies ist die wohl bekannteste „explosive Kombination“. Die Welle sucht Nähe – die Insel zieht sich zurück. Je mehr die Welle klammert, desto mehr Distanz schafft die Insel. Je mehr die Insel sich entzieht, desto verzweifelter rennt die Welle hinterher.
Stolperfallen:
- Ein klassischer Verfolger-Rückzugs-Mechanismus: Beide bedienen gegenseitig genau die Angst des anderen.
- Es entsteht ein Muster aus Vorwurf und Rückzug, das ohne Reflexion kaum durchbrochen werden kann.
Chancen:
- Erkenntnis ist der erste Schritt. Wenn beide sehen: „Das ist unser Muster, nicht unsere Schuld“, entsteht Luft.
- Die Insel kann lernen, kleine Portionen Nähe zu geben, ohne Angst, gefangen zu sein.
- Die Welle kann lernen, Pausen nicht als Ablehnung zu deuten, sondern als Selbstfürsorge.
- Diese Paare können enorme Entwicklungsschritte machen – wenn sie durchhalten. Denn kein Muster zwingt so stark zur Selbstreflexion und Bewusstheit wie dieses.
Unsicher-vermeidend + Unsicher-vermeidend (Insel + Insel)
Dynamik:
Zwei Menschen, die beide Autonomie lieben und Distanz bevorzugen. Konflikte werden vermieden, Emotionen oft heruntergespielt.
Stolperfallen:
- Gefahr von Parallelleben: Jeder lebt für sich, Nähe verkümmert.
- Körperlichkeit und Intimität werden leicht vernachlässigt.
Chancen:
- Mit bewusster Entscheidung für Nähe (Rituale, Berührung, Gespräche) können diese Paare eine stabile und ruhige Beziehung führen.
- Es braucht aktive Pflege, damit die Partnerschaft nicht zu einer Zweckgemeinschaft wird.
Unsicher-ambivalent + Unsicher-ambivalent (Welle + Welle)
Dynamik:
Zwei Menschen, die beide intensive Nähe und Rückversicherung suchen. Die Beziehung ist leidenschaftlich – und dramatisch.
Stolperfallen:
- Beide erwarten ständige Bestätigung.
- Eifersucht, Dramen, Überforderungen sind an der Tagesordnung.
Chancen:
- Wenn beide lernen, ihre Verlustängste zu beruhigen, kann daraus eine sehr lebendige, kreative Partnerschaft entstehen.
- Mit gemeinsamer Achtsamkeitspraxis und Beruhigungsstrategien (z. B. Atemübungen, Polyvagal-orientierte Selbstregulation) wird die Beziehung tragfähig.
Desorganisiert + …
Die desorganisierte Bindung ist die schwierigste Grundlage für Beziehungen. Nähe wird zugleich ersehnt und gefürchtet. Wer in der Kindheit Gewalt, Vernachlässigung oder massiven Stress erfahren hat, trägt diese Ambivalenz ins Erwachsenenleben.
Dynamik:
- Partner erleben Widersprüche: Suchen von Nähe und gleichzeitiges Zurückstoßen.
- Das Nervensystem ist oft im Alarmzustand.
Stolperfallen:
- Beziehungen sind instabil, geprägt von Angst vor Nähe und Angst vor Verlassenwerden zugleich.
- Partner fühlen sich oft wie in einem ständigen Wechsel von Anziehung und Abweisung.
Chancen:
- Heilung ist möglich – vor allem, wenn ein Partner sicher gebunden ist und konstant Sicherheit vermittelt.
- Traumatherapeutische Unterstützung ist oft notwendig.
- Wenn Stabilität entsteht, können desorganisiert Gebundene große Tiefe in eine Beziehung einbringen.
Bindung als Wachstumsweg
Jede Partnerschaft trägt das Potenzial zur Heilung in sich.
- Sicher gebundene Partner sind „Anker“, die Stabilität geben.
- Vermeidende Partner (Inseln) bringen Freiheit und Autonomie ein.
- Ambivalente Partner (Wellen) schenken Leidenschaft und Intensität.
- Desorganisierte Partner zeigen uns die Widersprüche und die Sehnsucht nach wahrer Sicherheit.
Es gibt keine „falschen Kombinationen“. Es gibt nur Beziehungen, in denen wir die Chance haben, Muster bewusst zu machen – und zu verwandeln.
Und ich kann das lernen. Ich weiß, ich kann meine Wirklichkeit verändern.
Außerdem ist Bindung in Bewegung
Vielleicht ist das die tiefste Wahrheit: Bindung ist kein starres Etikett. Sie ist ein Prozess.
Es geht darum, in mir selbst die sichere Basis zu entdecken, die mir von außen fehlte.
Darum, mich selbst zu halten – und dadurch fähig zu werden, gehalten zu werden.
Und darum, Bindung als das zu leben, was sie immer war: ein lebendiger Tanz zwischen Nähe und Distanz, zwischen mir und dir, zwischen Vergangenheit und Zukunft.
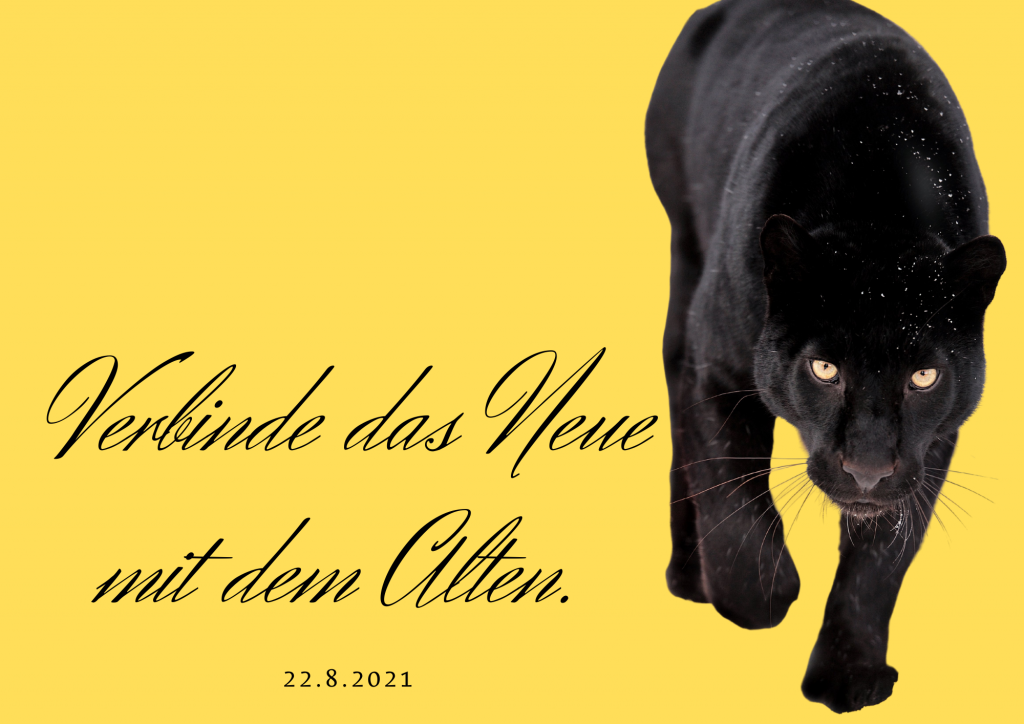
Niemand ist nur Insel, nur Welle, nur Anker. Hier bringt mich Diane Poole Heller mit ihrem Ansatz weiter. Sie bestätigt mir, wie ich bislang jede Theorie verdaut habe: Nichts ist in Stein gemeißelt.
Alle Bindungsstile sind in uns lebendig.
Das bedeutet: Ich bin nicht „für immer vermeidend“, meine eigene Insel. In manchen Momenten meldet sich meine Welle – hungrig nach Nähe. Manchmal gelingt mir der Anker – ruhig, vertrauend, klar. Ich trage schließlich auch die Fähigkeit zur Ruhe und dadurch zur Koregulation anderer in mir.
Je nach Kontext und Stresslevel sind wir jemand anders.
- In stressigen Situationen aktiviert sich vielleicht der vermeidende Anteil – wir ziehen uns zurück, weil Nähe sich zu eng anfühlt.
- In anderen Momenten bricht der ambivalente Anteil hervor – wir sehnen uns nach Nähe und sind gleichzeitig voller Angst, abgelehnt zu werden.
- Manchmal erleben wir sogar die desorganisierte Seite – wir wollen Nähe und fürchten sie gleichzeitig, ein innerer Riss, der uns erstarren lässt.
- Und in ruhigen, verbundenen Momenten spüren wir unsere sichere Seite – die Fähigkeit, Nähe zu genießen, Vertrauen zu haben, uns zu öffnen.
Das bedeutet: Niemand ist nur Insel oder Welle. Wir sind ein lebendiges Spektrum, eine innere Landschaft von Anteilen. Und das Wichtigste: Die sichere Bindung ist immer in uns vorhanden. Sie kann wachsen, durch Erfahrungen von Sicherheit, durch verlässliche Beziehungen mit Menschen, die bleiben.
Warum dieser Blick Paare verändert
Wenn ich nicht mehr denke: „Mein Partner ist eben vermeidend, so ist er halt.“, sondern erkenne: „Da ist gerade der vermeidende Anteil aktiv – weil er sich schützen will“, dann kann ich mitfühlender reagieren.
Wenn ich selbst merke: „Jetzt meldet sich meine Welle, die so sehr Nähe will“, dann kann ich atmen, innehalten, mich selbst beruhigen – statt automatisch zu klammern.
Diese Sichtweise öffnet Beziehungen:
- Wir kämpfen weniger gegen das Muster.
- Wir erkennen, dass hinter jedem Verhalten ein Versuch steckt, sicher zu sein.
- Und wir kultivieren gemeinsam die sichere Seite in uns.
Das gibt Hoffnung. Denn wir können in uns selbst und miteinander die Erfahrungen nachnähren, die fehlten. Wir können neue Referenzen schaffen, die alten überschreiben – durch Selbstmitgefühl, durch das bewusste Wahrnehmen unserer Muster. Durch Innehalten.
Mein ganzes Leben ist, was die Bindungstheorie angeht, eine Wahrnehmungsschulung ohne Ziel – einfach spüren dürfen, in die Selbsterlaubnis zu gehen.
Es geht um die Bindung in jedem Moment. Und das sich daraus entwickelnde Gefühl der Verbundenheit. Zuallererst einmal mit mir selbst.
Wenn ich eine Bindung zu mir selbst eingehe, kann ich besser in Beziehung mit anderen treten.
Und wenn meine Worte, meine Gefühle, meine Erfahrungen im Bauch, im ganzen Körper ankommen dürfen, dann wirken diese wie die Berührung, die mir auf vielen Ebenen so fehlt.
Ich setze meine erlernten Erwartungen und mein Glaubenssystem frei und erkenne die Möglichkeit neuer Wege, entscheide mich anders, spule keine alten Muster mehr ab.
Und ich erkenne:
Es geht um Integration.
Ich weiß: Mein Körper kann lernen, dass Bindung heute etwas anderes ist als damals.
Bindung ist ein Kontinuum, ein lebendiges Zusammenspiel von Anteilen. Und je mehr wir lernen, diese Anteile wahrzunehmen, desto mehr kann die sichere Bindung in uns wachsen – nicht, indem wir die unsicheren Anteile loswerden, sondern indem wir sie integrieren. Denn es geht nicht vorrangig um Heilung, es geht darum, mit diesen unsicheren Anteilen zu zu sein.
Ich bin mir selbst die Antwort auf die Frage: Wie könnte der fehlende oder schiefgegangene Start ins Leben rückwirkend symbolisch nachgenährt werden?
Ressourcen.
Ich sehe sie überall. Meine inneren und äußeren Welten sind nur so gefüllt von Ressourcen. Man könnte sagen, es steckt mir in den Genen.
Ich sehe es wirklich als meinen Job, Menschen mit ihren eigenen Ressourcen zu verbinden. Es fällt mir wirklich leicht.
Eine meiner Superkräfte, die aus meiner vermeidenden Bindung und durch meine Liebe zum Pol der Autonomie entstanden ist.
Nicht umsonst bin ich Expertin für Nachnähren geworden.
Und ich hoffe, ich konnte mit diesem Artikel hilfreich sein. Er ist Jahre in mir gereift.